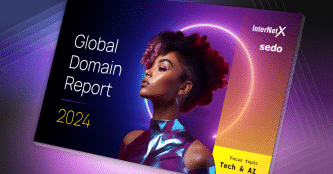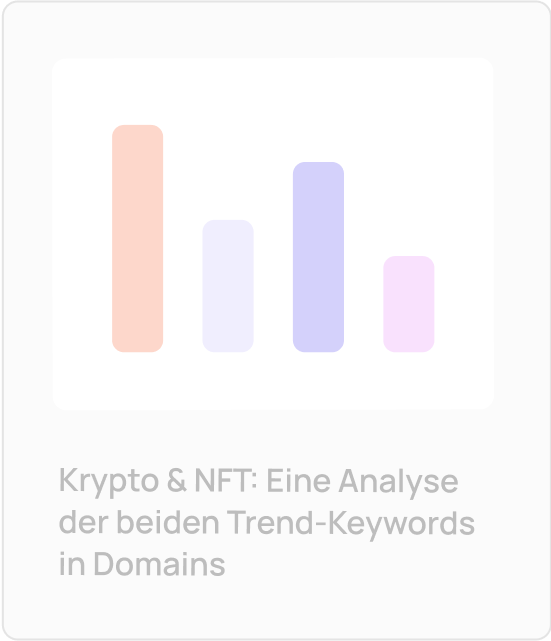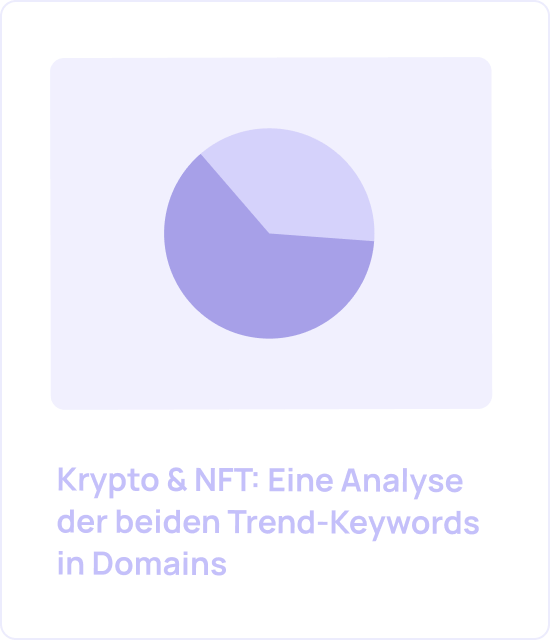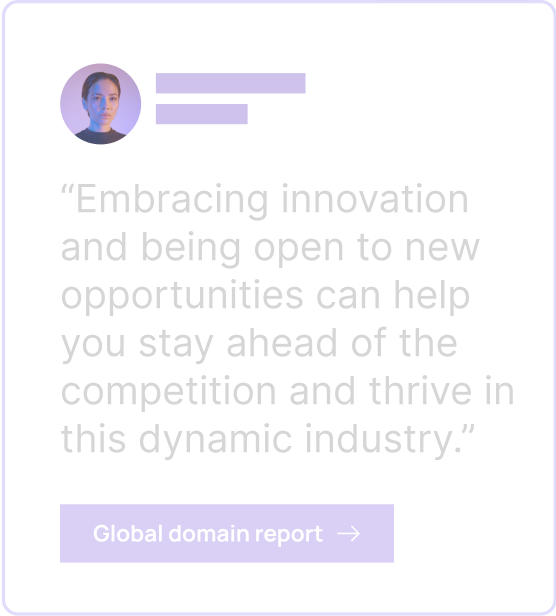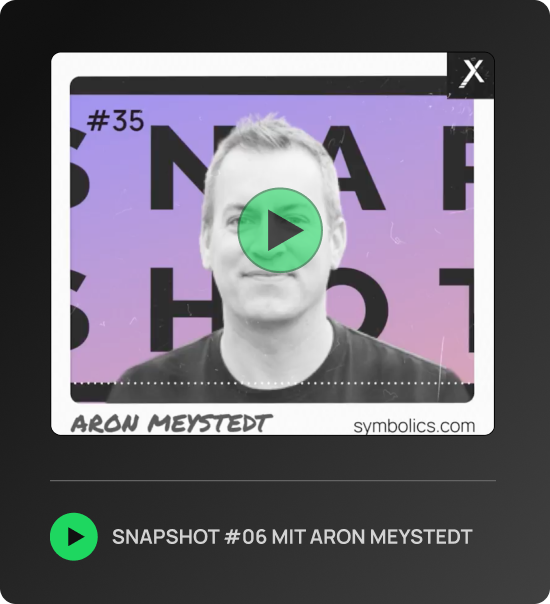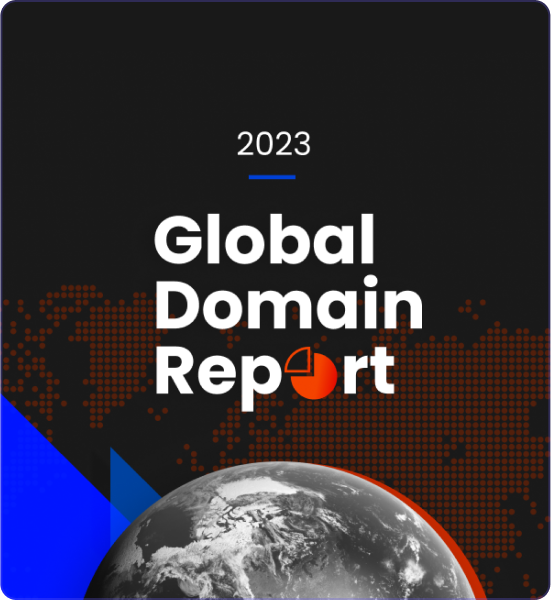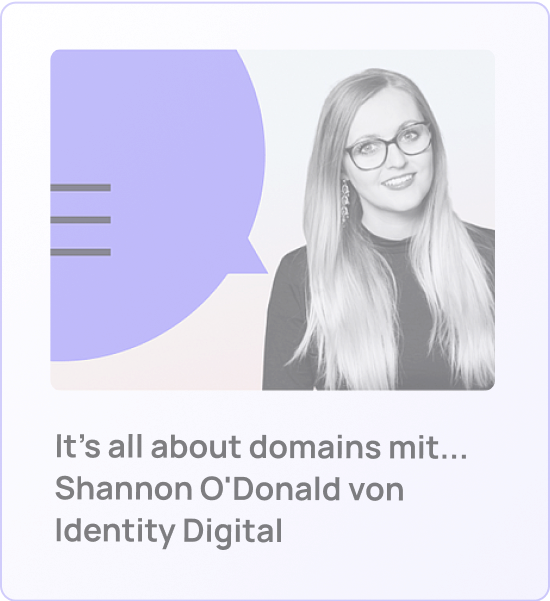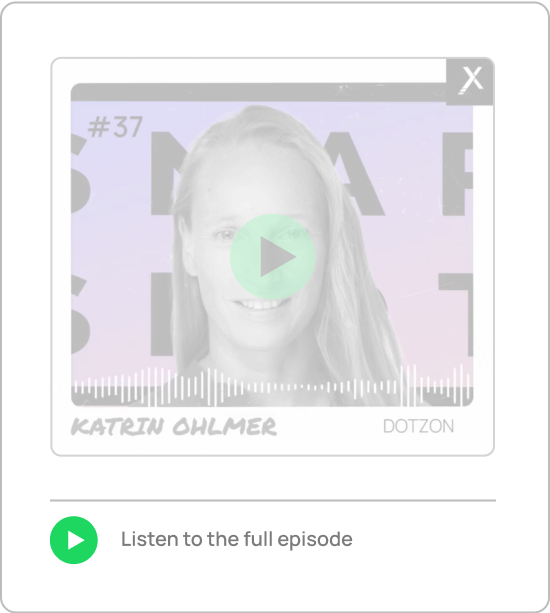Snapshot
Newsbytes zu IT-Themen rund um Domains, Hosting und Encryption. Hier teilen Profis ihr Wissen und geben Insights in aktuelle Trends und Entwicklungen.
Domains /
Einfach mehr Wissen. Über die Botschafter von Ideen und Visionen im Netz.
Hosting /
Infrastructure-as-a-Service & Cloud-Reselling Tipps auf den Punkt gebracht.
Encryption /
Auf den neuesten Stand bleiben, wenn's um Internet Security geht.
Deep Dives. 

Global Domain Report 2024 
Begleiten Sie uns auf eine faszinierende Reise, auf der wir die entscheidende Rolle von KI...

NIS-2 | Ein Fakten-Check 
Unser E-Paper bietet eine ausführliche Analyse der Rechtsvorschriften sowie die wichtigsten Schlüsselaspekte der NIS-2-Richtlinie. Mit...

Wie grün können Data Center sein? 
Kann Hardware “grün” sein? Und ökologisch betrieben werden? In unserem Green Paper erfahren Sie, welche...

Global Domain Report 2023 
Der Global Domain Report 2023 entfaltet eine spannende 360°-Perspektive auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Domain-Industrie. Tauchen Sie...